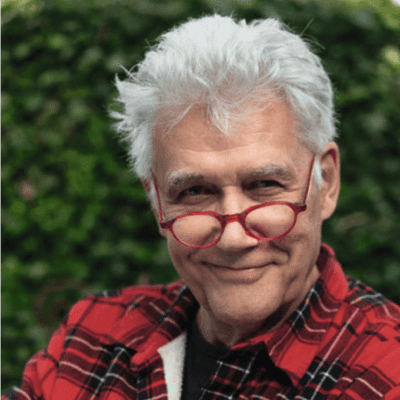Der Pastor von St. Pauli, Hilflose Regierende, Helfende Bürger
Rund 300 afrikanische Menschen zeigen seit Anfang Juni, wie weltoffen Hamburg tatsächlich ist. Und immer mehr Hamburger helfen, nicht einfach wie die SPD abzuschieben und das Tor zur Welt zu vernageln.
Zentrum des Protests ist der Ort, der auf dem Kiez definitiv der friedlichste ist – die St. Pauli Kirche. Ein Idyll zwischen Hafenstraße, Golden Pudel Club und Pinnasberg. Und in diesen Wochen ein Ruheplatz: Rund 80 der etwa 300 Flüchtlinge übernachten hier im Inneren der Kirche, am Morgen gibt es Frühstück vorm Altar und den Tag verbringen die Menschen in der Stadt oder im Garten hinter der Kirche.
„Das Haus Gottes ist voll. So voll, dass man es sich gar nicht vorstellen kann“, sagt Sieghard Wilm, einer der Pastoren der St. Pauli Kirche, einer, der nicht lange zögerte und den Flüchtlingen die Türen zur Kirche öffnete. Wilm, der privat und beruflich Afrika gut kennt, nahm die Menschen auf, die Schutz und Ruhe an diesem Ort auf dem Kiez suchten. „Es geht hier um humanitäre Hilfe“, sagt Wilm und beschreibt die ersten Tage: „Das war ein völliges Chaos. Es musste schnell geholfen werden. Und es war großartig, wie viel spontane Hilfe uns erreichte. Menschen jeden Alters und jeder sozialen Herkunft brachten Spenden, lieferten Essen, waren einfach da.“
Und es werden immer mehr, die einfach etwas tun. Da liefern Sterneköche aus Eppendorf täglich Suppen an, Ärzte untersuchen kostenlos die Flüchtlinge, Kiezianer, die selbst nur wenig haben, bringen Lebensmittel, manch einer fährt im Bentley vor, legt schweigend einen großen Geldschein in die bereitstehende Spendenkasse, wünscht viel Erfolg und fährt wieder weiter. Oder es ist eine alte Frau mit Gehhilfe, die einem der ehrenamtlichen Helfer eine Spieluhr in die Hand drückt mit den Worten: „Damit die Menschen in der Kirche schöne Musik hören und friedlich einschlafen können“. Tausende kleine und große Gesten einer Millionenstadt.
Woher kommen die afrikanischen Flüchtlinge, fragen ein paar Schüler, die vom nahen Skate-Platz den Weg in den Garten gefunden haben. Nüchtern erzählt geht das schnell: Sie heuerten als Arbeiter und Fachkräfte, meisten im Baugewerbe, vor vielen Jahren in Libyen an. Viele von ihnen stammen aus Westafrika – aus Ghana, Nigeria, Mali, Togo. Sie flohen vor den politischen Zuständen oder der wirtschaftlichen Not. Im freien Lybien von Gaddafi fanden sie Jobs, Hoffnung, eine Zukunft. Für sich und ihre Familien in der Heimat. 2011 der libysche Nato-Krieg. Wieder auf der Flucht. Mit völlig überladenen Booten über das Mittelmeer in Richtung der kleinen italienischen Insel Lampedusa. Viele von den ungezählt tausenden Flüchtlingen haben diesen kleinen Flecken EU im Meer nie erreicht, sondern sind verschwunden. Verreckt. In stickigen Laderäumen. Oder ertrunken beim Untergang der verrotteten Schlauch- und Fischerboote, auf die man sie in libyschen Häfen getrieben hat. Wie viele dieser Flüchtlinge starben, weiß kein Mensch. Die Überlebenden wurden auf Flüchtlingslager in ganz Italien verteilt. Mitten im Winter 2012 haben ihnen die italienischen Behörden pro Person zwischen 300 und 500 Euro in die Hand gedrückt, ein Touristen-Visum für den Schengen-Raum gegeben und weggeschickt. Vielen wurde gesagt: „Geht nach Deutschland. Oder wohin ihr auch kommt. Nur kommt nie wieder zurück nach Italien.“…
Die komplette Story gibt’s im aktuellen OXMOX!